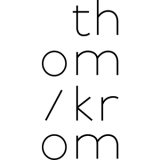Schmidt & Schmidt bietet Ihnen Apostille aus Staaten in Europa und EU, die dem Haager Übereinkommen von 1961 zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation beigetreten sind, an.
Diese Staaten erkennen gegenseitig die Rechtskraft der Urkunden mit Apostille an. Dies mindert den Kostenaufwand, der aufgrund der Beglaubigung entsteht. Alle Staaten in Europa und EU haben die Legalisation durch Apostille anerkannt.
Die Apostille ist ein Stempel in der Form eines Quadrates. Sie kann in der Amtssprache der ausstellenden Behörde ausgefüllt sein. Die Überschrift „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)“ ist zwingend in französischer Sprache vorgesehen. Jede Apostille ist registriert und enthält das Ausstelldatum und einzigartige Nummer.
Die Apostille wird von den staatlichen Stellen für Urkunden aus dem Tätigkeitsbereich der Stelle ausgestellt. Die konsularische Legalisation durch Apostille erfolgt in dem Land, wo das Dokument ausgestellt wurde.
Mehr Informationen über Zuständigkeiten und Besonderheiten des Prozedere entnehmen Sie unseren Länderinformationen.
Anerkennung der Echtheit öffentlicher Urkunden innerhalb der EU
In der Europäischen Union wurde der internationale Urkundenverkehr durch eine Reihe von Verordnungen und völkerrechtlichen Abkommen deutlich vereinfacht. Wenn Behörden in einem Mitgliedstaat mit Dokumenten aus einem anderen EU- oder Nachbarstaat arbeiten, gelten heute oft erleichterte Verfahren zur Echtheitsprüfung. Das betrifft insbesondere Urkunden, die von staatlichen Verwaltungsbehörden ausgestellt wurden – etwa Geburtsurkunden, Heiratsurkunden oder Schulbescheinigungen.
Bilaterale völkerrechtliche Verträge
Deutschland hat mit mehreren europäischen Staaten spezielle bilaterale Abkommen geschlossen, die vorsehen, dass bestimmte öffentliche Urkunden ohne zusätzliche Echtheitsnachweise anerkannt werden. In der Praxis bedeutet das: Wenn eine Urkunde von einer zuständigen Verwaltungsbehörde korrekt ausgestellt und mit dem offiziellen Siegel versehen ist, ist weder eine Apostille noch eine konsularische Legalisation erforderlich.
Diese Abkommen gelten in der Regel für verwaltungsbehördlich ausgestellte Urkunden, wie z. B. Personenstandsurkunden, Schul- oder Verwaltungsnachweise. Wichtig ist: Die genauen Regelungen können je nach Land und Art des Dokuments variieren.
Solche Abkommen bestehen unter anderem mit Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Sie betreffen in der Regel Dokumente, die von Behörden und nicht von Notaren ausgestellt wurden.
Dennoch ist Vorsicht geboten: In manchen Ländern werden die Abkommen nicht vollständig umgesetzt. So kann es etwa vorkommen, dass belgische Behörden trotz bestehendem Abkommen weiterhin eine Apostille verlangen. Auch das Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz aus dem Jahr 1907 gilt beispielsweise nicht für notarielle Urkunden, die daher weiterhin beglaubigt werden müssen.
Mehrsprachige Urkunden (nach CIEC–Übereinkommen)
Zusätzlich zu den bilateralen Abkommen existieren auch internationale Übereinkommen, die den Austausch von Personenstandsurkunden innerhalb Europas vereinfachen. Besonders hervorzuheben sind die Übereinkommen der Internationalen Kommission für das Zivil- und Personenstandswesen (CIEC). Sie ermöglichen die Ausstellung standardisierter mehrsprachiger Urkunden, die in anderen Mitgliedsstaaten ohne Apostille oder Legalisation verwendet werden können.
Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden, die im Rahmen des Wiener CIEC-Übereinkommens von 1976 erstellt wurden, sind in zahlreichen Staaten – darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, die Niederlande und viele weitere – direkt verwendbar. Für Ehefähigkeitszeugnisse gilt das Münchener CIEC-Übereinkommen von 1980 mit einer etwas kleineren Zahl von Vertragsstaaten.
EU-Verordnung über öffentliche Urkunden (2016/1191)
Ein weiterer bedeutender Schritt zur Vereinfachung des Urkundenverkehrs wurde auf EU-Ebene mit der Verordnung 2016/1191 unternommen. Diese gilt seit 2019 und befreit bestimmte öffentliche Urkunden – etwa Geburtsurkunden, Heiratsurkunden oder Meldebescheinigungen – von der Pflicht zur Apostillierung, wenn sie in einem EU-Mitgliedstaat ausgestellt und in einem anderen verwendet werden sollen. Ziel der Verordnung ist es, bürokratische Hürden abzubauen und den Verwaltungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger innerhalb der EU zu reduzieren.
⚠️ Wichtig zu wissen: Gesellschaftsrechtliche Dokumente – wie Handelsregisterauszüge oder Satzungen – fallen nicht unter die Verordnung. Für diese ist nach wie vor eine Apostille oder konsularische Legalisation notwendig.
Digitalisierungsrichtlinie II
Im März 2023 hat die Europäische Kommission einen neuen Gesetzgebungsvorschlag im Bereich des Gesellschaftsrechts vorgelegt. Dieser zielt darauf ab, digitale Prozesse zu stärken und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit innerhalb der EU zu erleichtern. Ein zentrales Element des Vorschlags ist die Abschaffung der Apostillepflicht für gesellschaftsrechtliche Dokumente zwischen EU-Mitgliedstaaten.
Sollte diese sogenannte Digitalisierungsrichtlinie II umgesetzt werden, wäre dies ein weiterer Schritt hin zu einem vollständig digitalen und praxisorientierten Binnenmarkt. Unternehmen könnten dann ihre Dokumente deutlich einfacher europaweit verwenden, ohne sich mit zusätzlicher Beglaubigung befassen zu müssen.
Schmidt & Schmidt verfolgt die rechtlichen Entwicklungen im internationalen Urkundenverkehr laufend und unterstützt Sie dabei, von bestehenden Erleichterungen zu profitieren. Wir beraten Sie gern, welche Verfahren aktuell gelten und wie Ihre Dokumente schnell und rechtsgültig anerkannt werden können.